|
|
Das endgültige Ende |
 |
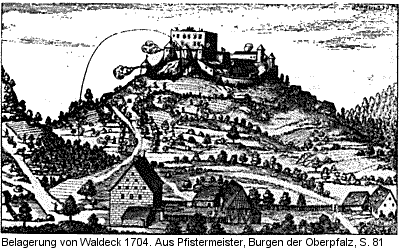
Etliche Burgen wurden trotz der im letzten Kapitel genannten Gründe bis ins 17. Jahrhundert von Pflegern verwaltet und von Garnisonen verteidigt. Den endgültigen Todesstoß versetzte vielen erst der Dreißigjährige Krieg. Reihenweise fielen die Burgen unter dem Ansturm schwedischer oder kaiserlicher Heere, 1621 Leuchtenberg, 1623 Burglengenfeld, Donaustauf, Kürnberg, 1634 Falkenstein, um nur einige Beispiele zu nennen. Gerade gegen Ende des Krieges ab Mitte der 30er Jahre bis 1648 wurden etliche Burgen zerstört, nachdem sich das Zentrum des Kriegs nach Süden verlagert hatte und die Schweden vermehrt Vorstöße nach Bayern unternahmen. 1704 wurden im Spanischen Erbfolgekrieg weitere Burgen zerstört.
Die so entstandenen Ruinen wurden in den folgenden Jahrhunderten als billige Steinbrüche von der umliegenden Bevölkerung benutzt (u.a. Wolfstein, Adelburg, Velburg). So kommt es, dass viele Burgen des Mittelalters heute fast völlig verschwunden sind (z.B. Möningerberg).
|
 |
 |
|
Das 19., 20. und 21. Jahrhundert |
 |
Ungeachtet all dieser Widrigkeiten könnten heute noch viele, viele Burgen in hervorragendem Zustand zu sehen sein. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden in Bayern jedoch die letzten selbstständigen kleinen Herrschaften im Zuge der Mediatisierung aufgelöst. Die Burgen und Schlösser dieser Herrschaften wurden an Privatleute verkauft und von diesen oft einfach abgebrochen und als Baumaterial verscherbelt (Sulzbürg, Tännesberg, Runding, Hohenfels u.a.). Der bayerische Staat, der sich die vielen kleinen Gebiete des geistlichen, mittleren und niederen Adels einverleibt hatte, konnte und wollte nicht für den Erhalt der zahlreichen Burgen aufkommen. Für uns mag das unverständlich sein. Doch die Menschen hatten damals eine andere, praktischere Einstellung zur Geschichte. Der Unterhalt einer Burg war (und ist) extrem teuer, Abriss oder Vernachlässigung waren (oft bis in unsere Tage) die logische Folge.
 Erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde man wieder auf die alten Gemäuer aufmerksam. Während in der Romantik die Ruinen zu Zeugen einer besseren Vergangenheit verklärt wurden, machte sich der Historismus die Rekonstruktion vergangener Epochen zur Aufgabe. Man war jetzt bereit, für den Erhalt und Wiederaufbau Geld aufzuwenden. So wurde z.B. die Burgen in Burglengenfeld und Prunn durch Intervention des bayerischen Königs Ludwig I. vor dem völligen Abbruch bewahrt. Man betrieb aber bald auch pseudohistorische Instandsetzungen, die das Aussehen vieler heute noch scheinbar völlig intakter Burgen prägen (z.B. in Falkenberg). Trotzdem setzte sich der Verfall bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts fort. So ist heute Wolfsegg bei Regensburg eine der wenigen vollständig erhaltenen, begehbaren Burgen mit überwiegend mittelalterlicher Bausubstanz. Erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde man wieder auf die alten Gemäuer aufmerksam. Während in der Romantik die Ruinen zu Zeugen einer besseren Vergangenheit verklärt wurden, machte sich der Historismus die Rekonstruktion vergangener Epochen zur Aufgabe. Man war jetzt bereit, für den Erhalt und Wiederaufbau Geld aufzuwenden. So wurde z.B. die Burgen in Burglengenfeld und Prunn durch Intervention des bayerischen Königs Ludwig I. vor dem völligen Abbruch bewahrt. Man betrieb aber bald auch pseudohistorische Instandsetzungen, die das Aussehen vieler heute noch scheinbar völlig intakter Burgen prägen (z.B. in Falkenberg). Trotzdem setzte sich der Verfall bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts fort. So ist heute Wolfsegg bei Regensburg eine der wenigen vollständig erhaltenen, begehbaren Burgen mit überwiegend mittelalterlicher Bausubstanz.
In neuerer Zeit hat das Interesse am Mittelalter und seinen baulichen Zeugen wieder stark zugenommen. Viele Gemeinden arbeiten daran, die historischen Reste ihrer Burgen instandzuhalten. Ab und zu werden sogar Anlagen wieder ausgegraben, wie in jüngster Zeit am Wolfstein bei Neumarkt zu beobachten war. Ein Problem, dass sich wiederum daraus ergibt: Diese Sanierungen geraten oft ein wenig zu umfangreich, statt nur zu sichern wird aufgemauert und rekonstruiert - nicht selten ohne dass Erhaltenes und Rekonstruiertes zu unterscheiden sind. Andere Ruinen sind dagegen völlig ohne Pflege. Man kann nur hoffen, dass Anlagen wie Zangenstein oder Sengersberg in absehbarer Zeit nicht ganz verschwunden sein werden.
|
 |
 |
|
Erstellt 9/2000, aktualisiert 4/2014.

|
