|
|
Bergfried
|
 |

Der Bergfried ist der wichtigste und höchste Turm einer Burg. Lange wurde vermutet, dass er einen letzten Rückzugspunkt bilden sollte, falls die Burg einem Angriff zum Opfer fiel. Dafür spricht der Hocheingang und die Stärke der Mauern: Zwischen 1.90 (Niederviehhausen) und 3.40 (Wolfstein) bewegen sich beispielhafte Größen. Gleichzeitig ist die Mauertechnik normalerwiese am Bergfried am sorgfältigsten gearbeitet, Quader oder Buckelquader sind hier häufig zu finden. Erst ab 1250 wurden vermehrt Bruchsteine verwendet. Allerdings spricht gegen diese Theorie, dass in den meisten Türmen nur Platz für eine Handvoll Verteidiger gewesen wäre. Auch für große Vorratslager war kein Platz, so dass sie sich dort nicht lange hätten halten können. Eher schon wurde der Bergfried als "Tresor" für die wertvollsten Besitztümer und wichtigsten Vorräte verwendet, aber auch als Wach- und Aussichtsturm. Eine weitere Funktion des Bergfrieds war zweifellos die psychologische: Er war das eindrucksvollste Symbol für die Stärke und den Machtanspruch seines Erbauers.
Der Bergfried steht in den meisten Fällen frei. Er kann aber auch mit einer oder mehreren Seiten in der Ringmauer stehen. Oft wurde er in die Nähe des Tores plaziert, um den Eingangsbereich zusätzlich zu sichern und die größte psychologische Wirkung zu erzielen. Der Grundriss ist in den meisten Fällen rund oder quadratisch. Doch gibt es viele Sonderformen wie Rechteck, Mehreck (Forstenberg, siehe unten Foto 3), Trapez (Randeck) oder Butterfass (Neuhaus: siehe unten Foto 4).
Der Eingang zum Bergfried war im Mittelalter immer einige Meter über dem Boden, Zugang erhielt man nur über Leitern, Holztreppen oder Strickleitern, die im Notfall eingezogen oder abgeworfen werden konnten. Die Tür war zusätzlich durch Balkenriegel gesichert. Die Decken zwischen den Stockwerken waren entweder eingezogene Balkendecken oder Gewölbe. Der unterste Raum, der meistens nur über eine Öffnung an der Decke (das sog. Angstloch) und eine Strickleiter zugänglich war, wurde später des öfteren als Verlies genutzt. Ebenerdige Eingänge in den untersten Stock sind immer erst später in die Mauer gebrochen worden, um Besuchern einen bequemeren Zugang zu ermöglichen, ebenso wie hölzerne Treppen, die in den ersten Stock führen. Original sind dagegen Treppen, die in der Mauer verlaufen, sie führen vom ersten Stock in die oberen Stockwerke. (Wolfstein).




|
 |
 |
|
Wohnturm
|
 |
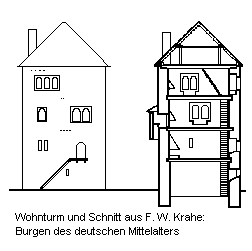
Der Wohnturm vereint in sich Elemente des Bergfrieds und des Palas: Er wird ständig bewohnt und bietet deshalb eine gehobene Ausstattung: Aborterker, Kamin (z.B. im Wohnturm von Flossenbürg, der außerhalb der Ringmauer steht) und größere verzierte Fenster (Stockenfels). Der Verteidigungscharakter tritt bei den unteren Geschossen hervor: Dort gibt es oft dickere Mauern und Lichtscharten.
Die Wohnfläche ist normalerweise größer, die Mauerstärke kleiner als beim Bergfried. Der Eingang befindet sich wie beim wehrhafteren Bruder mehrere Meter über dem Boden. Wenn ein Wohnturm vorhanden war, konnte man dafür eventuell auf separaten Bergfried und Palas verzichten, er ist deshalb vor allem für kleine Burgen vorteilhaft (Schwärzenberg, Lobenstein) und im späten Mittelalter die bevorzugte Lösung - wohl auch, weil erkannt wurde, dass der Bergfried bei der Verteidigung keinen entscheidenden Vorteil bringt. Vorbild waren die in Frankreich und Großbritannien verbreiteten "Donjons" und "Keeps", gut ausgestattete, komfortable Wohntürme.
|
 |

|
 |
|
Torturm
|
 |
 Die Verteidigung des Eingangs nimmt bei der Sicherung einer Burg immer eine zentrale Stellung ein. Eine Möglichkeit seines Schutzes ist es, den Bergfried in seiner Nähe zu erbauen (Pfaffenhofen, Burglengenfeld). Andererseits kann man den Weg zur Burg an gut gesicherten Mauern und Türmen vorbeiführen (Wolfsegg) oder ihn im Burggraben verlaufen lassen. Einfache Tore werden dann und wann von Türmen oder halbrunden Türmchen flankiert. Bei Felsturmburgen war der Zugang über Leitern und Treppen meist so schwierig, dass keine zusätzliche Sicherung des Eingangs notwendig war.
Die Verteidigung des Eingangs nimmt bei der Sicherung einer Burg immer eine zentrale Stellung ein. Eine Möglichkeit seines Schutzes ist es, den Bergfried in seiner Nähe zu erbauen (Pfaffenhofen, Burglengenfeld). Andererseits kann man den Weg zur Burg an gut gesicherten Mauern und Türmen vorbeiführen (Wolfsegg) oder ihn im Burggraben verlaufen lassen. Einfache Tore werden dann und wann von Türmen oder halbrunden Türmchen flankiert. Bei Felsturmburgen war der Zugang über Leitern und Treppen meist so schwierig, dass keine zusätzliche Sicherung des Eingangs notwendig war.
Eine häufige Art, den Eingang zu schützen, (oft auch in Kombination zu den ersten) war die Errichtung eines Torturmes. Den Zugang bildet eine Zugbrücke, die über einen Graben führte und hochgezogen werden konnte . Intakte Zugbrücken gibt es so gut wie keine mehr, man erkennt aber ihr Vorhandensein an den Kettenöffnungen links und rechts des Eingangs und der Nische, in der die Brückenplattform versenkt wurde (siehe Bild: Donaustauf). Das Tor selbst wurde zusätzlich durch Riegel verstärkt, wie man an den häufig noch sichtbaren Balkenlöchern erkennen kann.
Manchmal sicherte man die Burgen auch durch mehrere Tore (Donaustauf) hintereinander, gleichzeitig konnte ein Torturm zwei Barrieren bilden: den vorderen und den hinteren Durchgang (manchmal auch ein Fallgatter). Wenn der Angreifer sich zwischen den beiden Tordurchgängen befand, beschossen und bewarfen ihn die Verteidiger von oben. Um nicht immer das große Tor öffnen und schließen zu müssen, baute man kleinere Zusatztüren (sog. Mannslöcher) oder separate, kleinere Eingänge in das Tor ein (Bsp. Wernberg, Kürnberg). Weitere Verteidigungsmöglichkeiten der Türme nach außen waren Schießscharten und Gusserker, über die Angreifer mit Unrat, Gülle, heißem Wasser, Öl oder Pech beschüttet werden konnten.
|
 |
 |
|
Erstellt 9/2000, aktualisiert 4/2014.

|
